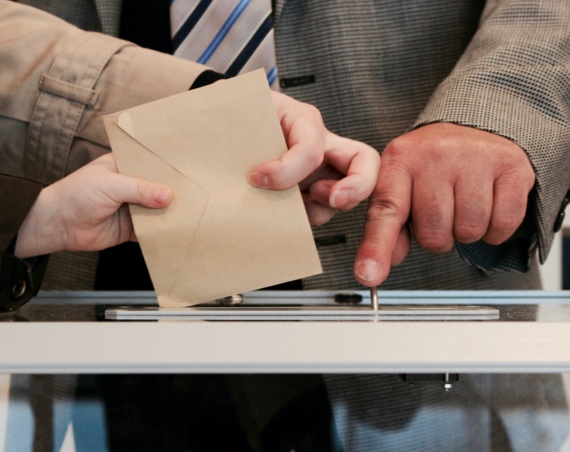Die inflationäre Verwendung von „Demokratie“
Der Begriff „Demokratie“ wird in der Architekturtheorie häufig bemüht, um partizipative Ansätze zu legitimieren oder zu kritisieren. Die Bürgerpartizipation, bei der lokale Gemeinschaften in Planungsprozesse einbezogen werden, ist ein essenzielles Instrument zur Steigerung von Akzeptanz und Qualität. Sie ist eine Form eines erweiterten, angewandten Diskurses, der über die Mindestanforderungen des Rechtsstaats hinausgeht.
Problematisch wird es jedoch, wenn die Begriffe verwechselt werden. In der Schweizer Architekturpraxis entsteht demokratische Legitimation nicht durch beliebige Bürgerforen, sondern durch klar definierte Volksabstimmungen auf Gemeinde-, Kantons- oder Bundesebene. Partizipation ist ein wertvolles Instrument, um Akzeptanz zu sichern – doch sie ersetzt nicht das formelle Mandat, das einzig eine Volksabstimmung gewährleisten kann. Fehlende Partizipation mindert zwar die Akzeptanz, aber nicht die Legitimität. Die pauschale Kritik, ein Projekt sei „undemokratisch“, nur weil es keine oder zu wenig Partizipation gab, verkennt die formelle Macht der Stimmbürger und verwässert damit den Kernbegriff der Demokratie.
Die Überstrapazierung des „Kapitalismus“
Ebenso wird der „Kapitalismus“ als universeller Erklärungsansatz missbraucht. Anstatt differenzierte wirtschaftliche Faktoren zu analysieren – wie die Deregulierung des Immobilienmarktes, spezifische Finanzierungsmodelle oder die Logik des globalen Bauwesens – wird jede marktgerechte Entwicklung pauschal als „Ausdruck des Kapitalismus“ bezeichnet. Dies ist intellektuell bequem, aber wissenschaftlich ungenau.
Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, in dem die Produktionsmittel mehrheitlich in Privatbesitz sind und von Einzelpersonen oder Unternehmen kontrolliert werden. So kann man durchaus sagen, die Höhe der Wolkenkratzer in den USA des späten 19. Jahrhunderts seien ein Beispiel für den Einfluss des Kapitalismus: Deren Höhe war ja direkt an die wirtschaftliche Effizienz und Profitmaximierung gebunden. Im Gegensatz dazu kann man die Umweltzerstörung nicht einfach dem Kapitalismus zuzuordnen, da sie primär aus der Industrialisierung und dem Fehlen effektiver Umweltregulierung resultiert, was sowohl in kapitalistischen als auch in staatssozialistischen Systemen wie der Sowjetunion oder der DDR zu massiven ökologischen Schäden führte.
Ist es wirklich zielführend, jede städtebauliche Entscheidung reflexhaft als Abbild kapitalistischer Machtstrukturen abzutun? Wenn z. B. die austauschbare Fassade eines Bürogebäudes als „Ausdruck des globalen Kapitalismus“ bezeichnet wird, verliert der Begriff seine Aussagekraft. Er subsumiert die ästhetische Gleichförmigkeit unter ein einziges Etikett, anstatt differenzierte Faktoren wie Bauvorschriften, Materialkosten oder spezifische unternehmerische Bedürfnisse zu analysieren. Solche inflationären Verwendungen machen es aus meiner Sicht unmöglich, die konkreten ökonomischen Einflüsse auf die gebaute Umwelt zu verstehen.
Wo liegt die Gefahr?
Die Überstrapazierung von „Demokratie“ und „Kapitalismus“ ist nicht nur analytisch unsauber, sondern auch rhetorisch und ideologisch gefährlich. Sie suggeriert eine Kausalkette, die oft nicht existiert, und macht komplexe Zusammenhänge oberflächlich fassbar. Das Ergebnis ist ein intellektueller Kurzschluss. Anstatt die spezifischen sozialen, kulturellen und ökonomischen Treiber eines Phänomens zu benennen, wird alles unter einem dieser beiden Schlagworte begraben.
Zusammengefasst: «Demokratie» und «Kapitalismus» sind keine Allzweckwaffen und Totschlagsargumente, sondern sollen als präzise Begriffe gezielt und überlegt eingesetzt werden.
Bildnachweis: Foto von Paul Teysen auf Unsplash