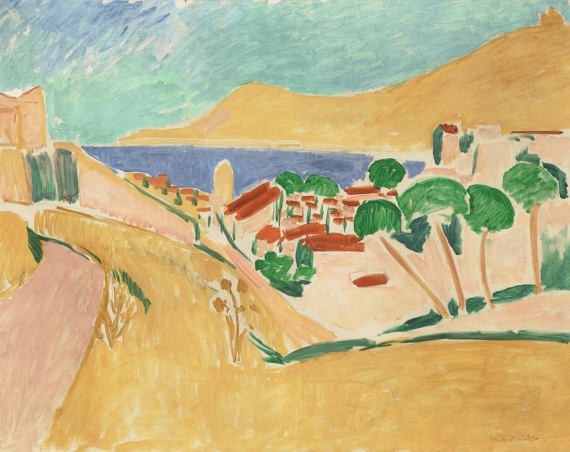Als ehemaliger Präsident des Quartiervereins Enge organisiere ich gelegentlich Führungen durch mein Quartier und begegne dabei immer wieder der Häuserzeile von Chiodera & Tschudy am Bleicherweg. Meine Faszination für dieses Ensemble, und für die Belle Époque generell, hat mich dazu bewogen, es mittels einer Semesterarbeit im Rahmen meines Studiums an der ETH Zürich eingehend zu untersuchen. Ich ging von der Hypothese aus, dass die Architekten mit diesen Bauten eine vielschichtige Strategie verfolgten: Sie wollten die Gebäude nicht nur als Kapitalanlage und Altersvorsorge nutzen, sondern auch als Experimentierfeld für ihre architektonischen Ideen, als Marketinginstrument für ihr Schaffen und als Geschäftssitz.
In meiner Recherche habe ich mich primär auf Sekundärquellen wie amtliche Dokumente, zeitgenössische Medien und kunsthistorische Publikationen gestützt, da es keinen Nachlass des Architekturbüros gibt. Offenbar haben die Erben die Dokumente in den 1950er-Jahren vernichtetet.
Die Enge als idealer Standort in der Belle Époque
Die Baugeschichte des Ensembles ist eng mit der rasanten Stadtentwicklung Zürichs und insbesondere der Eingemeindung der Enge im Jahr 1893 verbunden. Die Enge profitierte enorm von den Seeuferanlagen und entwickelte sich zu einem wohlhabenden Quartier. Der Bleicherweg war eine wichtige Verkehrsachse und bot sich als Standort für Wohn- und Geschäftshäuser an. Offenbar war das Areal, auf dem das Ensemble steht, ein “Restgrundstück”, das für grosse Bauspekulanten unattraktiv war. Dies könnte der Grund sein, warum Chiodera & Tschudy überhaupt die Möglichkeit hatten, das Grundstück zu erwerben.
Die fünf Gebäude am Bleicherweg 37-47 sind ein hervorragendes Beispiel für das Schaffen von Chiodera & Tschudy. Sie zeigen eine stilistische Vielfalt vom Historismus bis zum Jugendstil. Das «Chachelihuus» (Bleicherweg 47) ist besonders faszinierend, da es eine bewusste Abkehr vom etablierten Stil darstellt und mit seinen Kacheln und dem grossen Atelierfenster ein experimenteller Bau war. Es diente nicht nur als Wohnhaus, sondern auch als künstlerisches Atelier für Alfred Chiodera.
Ein Architekturbüro expandiert, testet, stellt aus und etabliert sich
Meine Analyse der Eigentumsverhältnisse und der Mieterstruktur hat ergeben, dass die ursprüngliche These einer rein renditeorientierten Kapitalanlage nicht uneingeschränkt haltbar ist. Vielmehr diente das Ensemble in erster Linie als “Katalog” der gestalterischen Leistungsfähigkeit des Büros. Der Bau war zudem der Firmensitz der beiden Architekten und ein strategisches Instrument, um ihre Marktposition zu stärken. Dies steht im Gegensatz zu risikofreudigeren Unternehmern wie Heinrich Ernst. Die Tatsache, dass sich die Bauarbeiten über ein Jahrzehnt erstreckten, erklärt sich auch durch den konservativen Ansatz von Chiodera & Tschudy, welche die Bauten schrittweise mit dem eigenen erwirtschafteten Kapital und massvollen Hypotheken finanzierten.
Zusammenfassend zeigt die Arbeit, wie sich in der Belle Époque ein Architekturbüro strategisch positionierte und weiterentwickelte. Dabei waren ästhetische Innovation, wirtschaftliches Kalkül und urbane Entwicklung in Zürich eng miteinander verwoben.
PS: Ein grosses Dankeschön den Mitarbeitenden der ETH-Baubibliothek, des Staatsarchivs, des Baugeschichtlichen Archivs, des Amts für Städtebaus und des Stadtarchivs der Stadt Zürich, welche mich im Rahmen der Recherchen unkompliziert und kompetent unterstützt haben. Ich bedanke mich ferner bei Anita Gut, Clemens Schuster und Tuba Edis für ihre hilfreichen Anmerkungen.
Bildnachweis: Adolf Moser, Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich, 1904